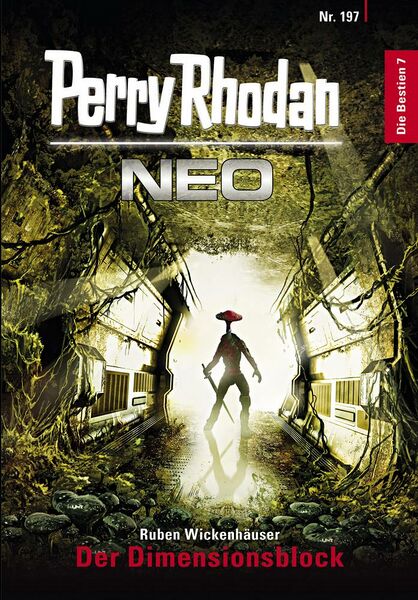Nachdem ich mich am Dienstag seit langem mal wieder auf die Waage gestellt habe und mich dabei der blanke Schrecken ereilte, habe ich beschlossen, diese Woche nach der Arbeit nach Hause zu »walken«. Drei Kilometer sind keine Entfernung, außerdem war das Wetter schön, da macht so ein bisschen Bewegung Spaß.
Sport gehörte in der Schule nie zu meinen Lieblingsfächern. Mich als unsportlich zu bezeichnen, soweit würde ich nicht gehen. Ich war halt dünn, zierlich und hatte kaum Kraft. Mir lagen eben nicht alle Sportarten, die wir im Sportunterricht exerzieren mussten. In Ballsportarten war ich eine Niete. Ich hasste Volleyball, weil ich mir dabei regelmäßig die Handgelenke aufschlug. Beim Basketball traf ich nicht, wurde dafür aber beim Völkerball regelmäßig schmerzhaft abgeschossen. In der Leichtathletik gab es Sportarten, die ich mochte und andere eher nicht. Hochsprung gefiel mir und ich gehörte dabei zu den besten in der Klasse. Leider durften wir nicht jede Sprungtechnik anwenden, weil die Matten nicht dazu ausgelegt waren. Daher war bei mir bei 1,15 m Schluss.
Was ich so gar nicht gern machte, waren Dauer- oder Crosslauf oder Kurzstreckenläufe. Ich schaffte niemals die geforderten Zeiten, um eine halbwegs vernünftige Zensur zu bekommen. Im 2000 Meterlauf kam ich stets keuchend als eine der letzten ins Ziel und bekam eine Fünf. Die Mädchen aus der Klasse, die gar nicht erst losgelaufen waren, lachten mich aus. Die bekamen auch eine Fünf, ohne sich dafür anzustrengen. Was ich echt ungerecht fand. Bei Weitwurf oder Kugelstoßen versagte ich ebenso. Wo sollte bei nicht mal 50 kg Lebendgewicht auch der Schwung herkommen.
An dieser Stelle muss ich mal abschweifen und erzählen, womit wir immer Weitwurf gemacht haben. Das glaubt mir immer keiner, wenn ich das erzähle. Wir warfen nicht mit Ball, Diskus oder Speer, wir warfen mit Handgranaten-Attrappen. Ja, ernsthaft. Das waren mit Sand gefüllte ausrangierte Handgranaten. Außerdem gab es Stöcke mit einem Metallende, die wir »Panzerfäuste« nannten. Die Jungs fanden das sicher gut. Wir Mädchen bekamen von der Lehrerin immer gesagt, dass wir mit in die Luft gehen würden, wenn die Granaten echt wären, weil wir nicht weit genug warfen. Auch eine Art der Motivation. Interessant ist, dass wir uns damals keine Gedanken darüber gemacht haben. Wenn ich heute daran denke, stellen sich mir die Haare auf. Schulkinder mit Handgranaten – unglaublich! Das gab es nur in Bürgerkriegsländern oder in der DDR.
Im Winter hatten wir immer Geräteturnen. Das liebte ich sehr und hier konnte ich endlich mit guten Noten punkten, um die schlechten Ergebnisse aus den anderen Sportarten auszubügeln. Bodenturnen und Pferdsprung gehörten zu meinen Favoriten. Beim Stufenbarren fehlte mir ein bisschen das Krafttraining. Ein oder zwei Jahre ging ich sogar in eine Sportgruppe für Geräteturnen. Ich war die Jüngste und wurde von den großen Mädels gnadenlos gemoppt, worauf ich irgendwann nicht mehr hinwollte.
Sportunterricht in der DDR war hart. Ich erinnere mich, wie ich beim Rundenlaufen auf dem Schulhof gestürzt war und die Lehrerin fragte, ob ich mir ein Pflaster aus dem Sekretariat holen dürfe. Ich durfte nicht. Ich musste die Sportstunde blutend beenden, um mich anschließend umziehen und im Sekretariat verarzten lassen. Dazu hatte ich zehn Minuten Zeit, so lang war die Pause bis zur nächsten Stunde. Hinzu kamen die hohen Anforderungen. Die DDR war ein Leistungssport-Land und das spiegelte sich im Sportunterricht wieder. Die Ansprüche stiegen von Klassenstufe zu Klassenstufe. Gute Noten bekamen nur die Sportasse, die dann irgendwann auf die Sportschule wechselten, wenn es ihre schulischen Leistungen erlaubten. Die unsportlichen, körperlichBeeinträchtigten fielen da hinten runter. Es gab so einige, denen der Schulsport das Zeugnis versaute. Eine Drei war das Beste, was ich am Ende des Schuljahres rausholen konnte. Dafür musste ich mich ziemlich anstrengen und schaffte es meist nur mit vielen Einsen im Geräteturnen.
Ich weiß nicht, wie der Sportunterricht heute so abläuft, aber so streng wie damals sicher nicht. Dennoch wäre ich dafür, Noten im Sportunterricht abzuschaffen. Sport soll Freude machen und keine Qual sein. Ich denke, dass viele als Erwachsene heute mehr Sport machen würden, wenn sie in der Schule nicht irgendwelche Traumata im Schulsport durchlitten hätten.